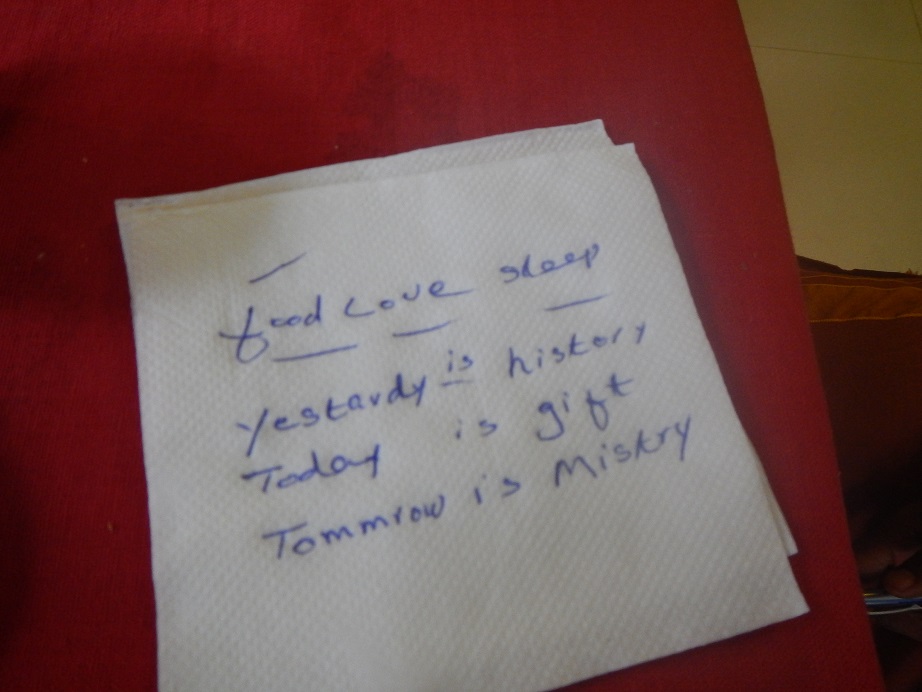Zugfahren erfordert in Indien viel Langmut, das haben wir bereits einmal erlebt.
Noch mehr Geduld braucht man nur, wenn man mit dem Schiff reist.
An dem Tag, als wir zu einer Trauminsel der Lakkadiven aufbrechen, wache ich schon um sechs Uhr auf, weil ich Panik habe, den Dampfer zu verpassen.
„Schnell“, treibe ich Petra an. „Sonst fährt das Schiff ohne uns los.“
„Ist ja gut“, sagt sie. „Bestimmt meinen die neun Uhr indischer Zeit.“
Als wir mit dem Tuk-Tuk zum Anleger kommen, ist es kurz vor halb neun.
Ich gähne verhalten.
Boarding Time soll um neun sein – die Dokumente für die Reise sollen wir in der Lakshadweep Wharf bekommen.
Nach kurzer Suche in der wuseligen Halle finde ich ein verblasstes Schild, das darauf hindeutet, dass sich das Büro für unsere Reiseleitung in der oberen Etage befindet.
Kann das sein?
Dort ist alles leer, bis auf eine Kammer, in der sich gelbe T-Shirts und weiße Basecaps mit Lakshadweep-Logo türmen.
Der kleine Mann hinter dem Schreibtisch nickt – schüttelt also den Kopf auf diese typisch indische Weise, als ich ihn frage, ob ich meine Reisedokumente für Kadmat bei ihm bekomme.
„Passport?“, fragt er.
Ich eile nach unten und lotse Petra aus dem Tuk-Tuk. Sie bezahlt den Fahrer und schickt ihn weg.
Dann schleppen wir uns mit den Rucksäcken in die obere Etage.
„Ob wir wohl jetzt so ein T-Shirt und so eine Kappe bekommen, das volle Touripaket?“, fragt Petra mich, als wir dem Mann die Pässe reichen.
Ich zucke mit den Schultern.
Der Mann drückt jeder von uns einen Ausdruck in die Hand und deutet nach unten.
„Boarding for Lakshadweep Sea, you go”, sagt er bestimmt.
Ohne Ferienpaket gehen wir nach unten.
Petra will noch eine Flasche Wasser an einem Verkaufsstand erwerben, unterdessen kommt ein Mann in grauer Uniform auf mich zu.
„Going Kadmat?“
Ich nicke.
Er will mich am Arm ziehen und deutet auf die beiden Schalter, an denen Uniformierte eine lange Schlange Reisender kontrollieren.
„Sorry, my friend is just buying some water …“
„Kadmat“, sagt er mit mehr Nachdruck. „Go.“
„Friend“, sage ich und deute auf Petra. „Buy. Water.“
Er nickt und zieht Leine.
Wir reihen uns ein.
„Wie früher in der DDR“, raunt Petra mir zu.
Wir sind umgeben von Männern in Uniform, die uns in Richtung eines Schalters drängen, wo ein in Khaki Gewandeter die zusammengehefteten Reiseunterlagen ein weiteres Mal akribisch prüft. Ein Blick in unsere Gesichter, ein weiterer in die Pässe, dann wieder ins Gesicht, dann wieder in den Pass – so genau bin ich das letzte Mal geprüft worden, als ich mit sechzehn in die angesagte Disko am Ort wollte.
Endlich auf dem Steg, gehen wir die paar Meter mit den Rollkoffern zum Schiff.
Es ist ein ziemlich großer Kahn, sieht von außen aus wie das Traumschiff.
Von innen, das merken wir schnell, ist es eher ein Albtraumschiff: Unsere Erste-Klasse-Kabine wirft sofort die Frage auf, wie denn dann die zweite und dritte Klasse ausschauen mögen.
Der Teppich ist verfilzt und voller handtellergroßer Flecken, Dusche und Handwaschbecken sind mehr schwarz als weiß, und es riecht im Zimmer nach Abfluss – warum, wird klar, als Petra den Entlüfter am Fußende ihres Bettes entdeckt.
„Puh“, meint sie, „dann lass uns doch lieber an Deck aufs Auslaufen des Schiffes warten.“
Im Stehen, hätte sie hinzufügen können – denn an Deck gibt es merkwürdigerweise keine Sitzgelegenheiten.
Es dauert sechs Stunden, bis alles an Bord ist – in etwa fünfeinhalb Stunden länger, als wir dachten.
„Wie gerne hätte ich noch ein paar Ausstellungen der Biennale gesehen“, seufzt Petra.
Am Tag zuvor haben wir nicht mehr alle Galerien in Kochi ablaufen können, uns fehlte die Zeit.
Und jetzt langweilen wir uns stundenlang an Bord eines Dampfers, auf dem es nicht mal Wifi gibt?
Ganz zu schweigen von Bänken an Deck?
Als es gegen halb vier Mittagessen gibt, wirft der Dampfer endlich seine Maschinen an.
Immerhin ist das Essen, das sie uns nun servieren, mehr als schmackhaft.
„Ich liiiiebe die indische Küche“, schwärmt Petra und nimmt sich noch was von dem scharfen Eintopf und dem Bohnengemüse mit Kokosraspeln.
Ich schnappe mir noch ein Roti-Brot und etwas Stippe und setze mich zu ihr.
Nach dem Essen würden wir gerne einen Kaffee trinken, aber Kaffee nach dem Essen kennt der Inder nicht. Es braucht alle unsere Überredungskünste, um aus dem Stewart eine Brühe herauszukitzeln, durch die eine Kaffeebohne offenbar durchgeschossen wurde.
Nachdem wir ein paar Stunden übers Wasser geschippert sind, wird es endlich dunkel.
Am nächsten Morgen sollen wir schon gegen elf in Kadmat sein.
Am besten, wir schlafen lange, dann zieht es sich nicht so.
Früh um sechs hämmert wer gegen die Tür.
„Breakfast!“ Dong, dong, dong. „First class! Breakfast!“
„Das ist nicht deren Ernst“, murmelt Petra verschlafen und dreht sich noch mal um.
„Breakfast!“ Dong, dong, dong.
Dong! Dong! Dong!
So lange, bis wir schließlich aufgeben und uns erheben.
Das Frühstück ist ein bisschen wie das Abendessen. Morgens um sieben kann ich warmem Eintopf mit indischen Tortillaverschnitten auch nach vier Wochen noch nichts abgewinnen.
Zu allen anderen Tageszeiten gern, aber morgens um halb sieben?
„Ich hol mir noch einen Nachschlag!“, verkündet Petra und steht auf. „Das schmeckt super!“
Die Schiffspassage dauert lange.
Sehr lange.
Unglaublich lange.
Man könnte auch sagen, sie zieht sich.
Gegen zehn erreichen wir eine Insel, die aussieht wie aus dem Reisekatalog: türkisblaue Lagune, Palmen, Sandstrand, Steg. Dort wird entladen, erst die nächste Insel ist unsre.
Dann erreichen wir Kadmat, ein längliches Eiland mit noch mehr Palmen und einer noch größeren Lagune.
Jedenfalls glauben wir, dass es Kadmat sein könnte.
Es ist schwer, herauszufinden, wie und wo der Abgang vom Boot stattfindet.
Erst müssen wir jemanden finden, der versteht, dass wir das wissen wollen.
Auf der Treppe treffe ich einen Mann, der so aussieht, als ob er auf dem Boot arbeitet.
„Kadmat?“, frage ich.
Er nickt.
„Where get off?“, beschränke ich mich auf die wichtigsten Wörter.
Er macht eine Handbewegung, die „Warten Sie bitte hier“, „Mir doch egal“ oder „Keine Ahnung“ bedeuten könnte.
„First Class?“, fragt er dann.
Ich nicke. „Yes.“
„Wait in cabin.“
„Wir sollen in der Kabine warten?“, fragt Petra, als ich wieder bei ihr bin. „Hoffentlich fährt das Boot dann nicht mit uns weiter.“
„Ich geh noch mal runter, dahin, wo wir eingestiegen sind“, sage ich. „Bleib du am besten hier, falls doch einer kommt.“
Als ich unten bin, stehen dort schon alle anderen mit ihren Taschen. Zwei indische Pärchen, die offenbar auf Honeymoon-Reise sind, ein älterer Mann, den ich auf dem Boot noch nicht gesehen hatte, und ein junger Typ, der vielleicht Saisonarbeiter ist.
Ich rase rauf zu Petra, aber die kommt mir schon entspannt entgegen.
„Der Stewart kümmert sich um die Rucksäcke.“
Es ist laut und voll unten in der dritten Klasse, wo der Ausstieg ist. Ich sehe Stockbetten, auf denen sich müde die Leute räkeln, die es sich nicht leisten können, so wie wir in einer versifften Erste-Klasse-Kabine zu logieren. Ihre Sachen liegen in den Gängen verstreut, Taschen und übervolle Plastiktüten sind übereinander gestapelt. An uns vorbei drängen sich Menschen in Uniform, und ich quetsche mich an die Wand. Hinter mir hat der Stewart die Koffer deponiert.
Endlich ist es soweit, wir werden auf das kleinere Boot hinauskatapultiert, das uns zur Mole bringen soll.
Das Wasser ist glasklar, der Strand ist so hell, dass es fast in den Augen weh tut.
Fische sehe ich von hier aus keine, die Lagune scheint leer zu sein.
Es ist unwirklich.
Am Steg wartet bereits ein Vehikel auf uns, auf dessen Ladefläche Platz für die Koffer ist – und für uns.
Als die beiden Pärchen und wir verladen sind, fahren wir auf einer wenig befestigten Straße zwischen halbfertigen Häusern und Müllsäcken, Palmen und Bauschutt über die Insel bis ans äußerste Ende.
Dort gibt es ein schwimmbadblau gestrichenes Tor, vor dem wir halten und unsere Passierscheine zeigen müssen.
Das Resort öffnet seine Pforte.
„Oh nein“, sagen Petra und ich wie aus einem Mund.
Es hatte sicher einen Grund, warum uns die Frau im von der Regierung autorisierten Reisebüro keine Bilder zeigen konnte.
Wir wären wahrscheinlich nicht hier, wenn sie das getan hätte.
Im Reiseführer steht, dass 28 kleine Hütten an einem malerischen Sandstrand stehen.
Die Wahrheit: Es handelt sich um schnöde Bungalows, die alle in schwimmbadblau gestrichen sind.
An den Funktionsgebäuden steht in weißer Schrift gepinselt: Cafeteria, Dive Center, Gym.
Wir sind eingesperrt in einem Touristenzoo, abgeschottet durch das schwimmbadblaue Tor.
Es ist nicht schön. Es wirkt ein wenig wie ein sozialistischer Freizeitpark.
Als wir an den Strand gehen, liegt überall Plastik.
Flaschen, hellblaue Fischernetze, leere Chipstüten, Bonbonpapierchen.
Ich kann es nicht liegen lassen, ich muss es aufsammeln.
Als wir an der Nordspitze der Insel stehen, habe ich die Hände voller Plastikmüll.
Tränen laufen mir über die Wangen.
Wir wollen weg.
Und sehen das Schiff in der Ferne davondampfen.
Da hilft zum allerersten Mal auch keine Kölsche Lebensweisheit.